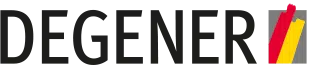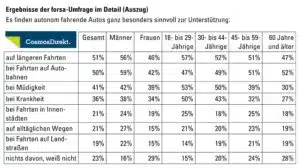Willkommen 2018!
Willkommen 2018!
 Es hat schon Tradition, dass der Verkehrsgerichtstag in Goslar gleich zu Jahresbeginn einige wichtige Themen in die Diskussion bringt, die die Verkehrspolitik betreffen – und manches Mal bestimmte Entwicklungen prägen können. Verkehrsexperten aus allen Bereichen, Anwälte, Fahrlehrer, Polizisten, Richter und Vertreter von Automobilklubs sowie anderen Verbänden treffen sich hier zum friedlichen Gedanken- und manchmal auch zum heftigeren Argumente-Austausch.
Es hat schon Tradition, dass der Verkehrsgerichtstag in Goslar gleich zu Jahresbeginn einige wichtige Themen in die Diskussion bringt, die die Verkehrspolitik betreffen – und manches Mal bestimmte Entwicklungen prägen können. Verkehrsexperten aus allen Bereichen, Anwälte, Fahrlehrer, Polizisten, Richter und Vertreter von Automobilklubs sowie anderen Verbänden treffen sich hier zum friedlichen Gedanken- und manchmal auch zum heftigeren Argumente-Austausch.
Neben den bereits ausgebuchten Arbeitskreisen V, VI und VII laden die Arbeitskreise III, II und I noch zum Mitreden ein. Hier geht es zum Beispiel um Forderungen privater Inkassobüros und von Anwälten aus Verkehrs- und Mautverstößen im Ausland. Hohe Inkassogebühren, Androhungen drastischer Sanktionen und unklare Abwehrmöglichkeiten sorgen für erhebliche Verunsicherung bei den Betroffenen (AK I). Oder die zivilrechtlichen Fragen zum Thema Automatisiertes Fahren, das zum Neujahrstag sogar Einzug in die ARD-Krimiserie Tatort gefunden hat: Wer haftet, wenn ein hochautomatisiertes Fahrzeug am Unfall beteiligt ist? Welchen Zugriff auf die unverfälschten Daten über den Betrieb der am Unfall beteiligten Fahrzeuge hat der Fahrer, wenn er ihrer bedarf (AK II)? Und, nicht zuletzt, die Frage, ob der Tatbestand „Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“ im Handyzeitalter noch zeitgemäß ist (AK III): Das Unerlaubte Entfernen vom Unfallort zieht strafrechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen nach sich. Der Straftatbestand des § 142 StGB stammt aus dem Jahr 1975 – einer kommunikationstechnischen Steinzeit. Ist es Zeit für eine Reform? Wer sich engagieren und mitreden möchte, kann das jetzt noch tun – ansonsten werden selbstverständlich wir Sie über die Empfehlungen der Arbeitskreise und sonstige zu erwartende Entwicklungen gern auf dem Laufenden halten. Willkommen im Jahr 2018!
DiH (Redaktion)