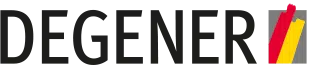Begleitetes Fahren 2.0: Mit 16 ans Steuer
Begleitetes Fahren 2.0: Mit 16 ans Steuer
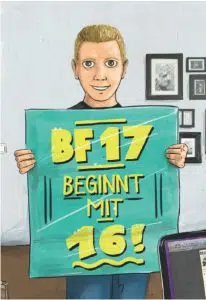
Bald schon mit 15 ½ Jahren zum Führerschein? © DEGENER
Fahrlehrerverbände und Verkehrsminister sind sich einig: Die positiven Erfahrungen seit der Einführung des Begleiteten Fahrens ab 17 können noch verbessert werden, wenn es gelingt, die Begleitphase auszudehnen. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies kündigt deshalb einen Modellversuch zum „Begleiteten Fahren ab 16“ für 2018 an.
Die Forderung ist nicht ganz neu, scheiterte aber bisher immer wieder an der EU-Führerscheinrichtlinie von 2006, die das Herabsetzen des Mindestalters für einen Führerschein der Klasse B nur bis auf 17 Jahre zulässt. Bereits 2013 habe der Verkehrsgerichtstag in Goslar empfohlen, eine Absenkung auf 16 Jahre zu prüfen, sagte der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen, Dieter Quentin.
Das größte Problem an der BF17-Regelung ist aus Sicht der Fahrlehrer bislang die tatsächliche Verkürzung: Viele BF17-Teilnehmer seien wegen Zeitmangels aufgrund von Belastungen durch Schule und Berufsausbildung in der Praxis erst wenige Wochen vor dem 18. Geburtstag mit der Ausbildung fertig. Entsprechend kurz sei die Begleitphase.
Olaf Lies wie Dieter Quentin halten Kritikern und Bedenkenträgern im NDR Fernsehinterview entgegen: Schon heute dürfen Jugendliche ab 16 Jahren – und ganz allein auf sich selbst gestellt, also ohne Begleitung – mit großen landwirtschaftlichen Zugmaschinen fahren (Klasse L und T). Und auch das Fahren mit höheren Geschwindigkeiten sei schon ab 16 möglich – sogar mit Sozius: Klasse A1 erlaubt das Fahren von Krafträdern mit Hubraum von nicht mehr als 125 cm³, einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW und Verhältnis der Leistung zum Gewicht max. 0,1 kW/kg, auch mit Beiwagen. Damit kann man sogar auf Autobahnen fahren und ins Ausland, was beim Begleiteten Fahren nicht der Fall ist …
Der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, Gerhard von Bressensdorf fasst die Empfehlung am Rande des diesjährigen Verkehrsgerichtstages zusammen: „Je länger man am begleiteten Fahren teilnimmt, desto größer ist der Erfolg.“
DiH (Redaktion)